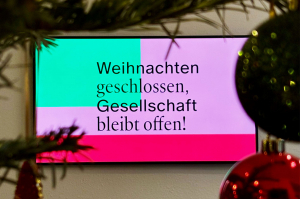„Wir wollen heute über die Gegenwart sprechen, über Verantwortung, die aus der Vergangenheit für uns resultiert“, betonte Professor Dr. Michael Grünberger, Präsident der Bucerius Law School, in seiner Begrüßung. Die Auseinandersetzung mit Raubkunst ist vielschichtig – das hob auch Stefanie Jaschke-Lohse, Bereichsleiterin Kunst & Kultur bei der ZEIT STIFTUNG BUCERIUS, an diesem Abend hervor – sei es in kolonialen Kontexten oder solchen der Zeit des Nationalsozialismus. Im Rahmen unserer Veranstaltungsreihe „Hinter den Bildern. Gespräche zu Kunst, Recht und Gesellschaft“, gemeinsam organisiert mit dem Studium generale der Bucerius Law School, kam an diesem Abend ein Expert:innen-Panel zusammen, um über aktuelle Debatten rund um die Restitution von Raubgut aus der deutschen Kolonialzeit zu diskutieren. Mit Moderator und Kulturjournalist Ralf Schlüter diskutierten auf der Bühne Eric Otieno Sumba, Politikwissenschaftler, Freier Autor und Redakteur im Berliner Haus der Kulturen der Welt, Barbara Plankensteiner, Ethnologin und Leiterin des Museums am Rothenbaum – Kulturen und Künste der Welt (MARKK) in Hamburg und der Anwalt Mathias Zintler, LL.M, KNPZ Rechtsanwälte.
Deutschland gehört zu den großen europäischen Kolonialmächten: Zu den vielen Regionen in Afrika, die von Deutschland beherrscht und ausgebeutet wurden, zählen unter anderem die heutigen Staaten Namibia, Kamerun, Tansania, Kongo und Nigeria. Im Kontext einer neuen Phase der Aufarbeitungen von Kolonialismus wird nun wieder intensiver über die Restitution von tausenden „Objekten“ gesprochen. Sie wurden während der Kolonialzeit unrechtmäßig aus Afrika entwendet und befinden sich heute in den Ausstellungen deutscher und europäischer Museen. Die Restitution gilt als gestartet – und gleichzeitig bestehen Zweifel daran, ob dem wirklich so ist, fasste Moderator Ralf Schlüter an diesem Abend zusammen. Warum aber verläuft der Prozess der Aufarbeitung so langsam? Welche konkreten Ergebnisse wurden bisher erzielt? Und herrscht tatsächlich Einigkeit darüber, dass die Restitution kolonialer Raubkunst sinnvoll ist?
„Restitution ist kein einseitiges Geschäft“
Barbara Plankensteiner, Leiterin des Museums am Rothenbaum (MARKK) in Hamburg, ist direkt an der groß angelegten Restitution der sogenannten Benin-Bronzen beteiligt. Im Rahmen der Diskussion gab sie Einblicke in die komplexe Praxis des Prozesses, der die Bestände von fünf deutschen Museen umfasst. 20 Werke wurden bereits 2022 physisch zurückgegeben, die Eigentumsrechte von insgesamt ca. 700 Werken an Nigeria übertragen. Ein Teil dieser Werke werde dennoch weiterhin in deutschen Museen als Dauerleihgaben gezeigt, könne aber auf Aufforderung jederzeit zurückgegeben werden. „Das ist ein partnerschaftliches Unternehmen und beide Seiten müssen sich auf diesen Prozess vorbereiten“, so Plankensteiner. Die Restitution kolonialer Raubkunst sei kompliziert, weil sie eine enge Zusammenarbeit zwischen deutschen Museen und afrikanischen Staaten erfordere, die selbst historisch gewachsene kulturelle und politische Strukturen berücksichtigen müssen. „In Deutschland hat es auch lange gedauert, sich zu organisieren“, ordnete Plankensteiner ein. „Auf dem afrikanischen Kontinent gibt es Nationalstaaten, die auf Basis von kolonial gezogenen Grenzen existieren und aber viele Einheiten in diesen Staaten, die verschiedenen Königtümer, Kultur- und Sprachregionen, von denen diese „Objekte“ kommen“. Man müsse bedenken, dass es manche Regierungen gäbe, die nicht unbedingt die Interessen aller Gemeinschaften vertreten. „Wir können uns in diese internen Angelegenheiten auch nicht einmischen“, argumentierte Plankensteiner. Dafür arbeite man mit auf staatlicher Ebene zusammengesetzten Kommissionen, die verschiedenen Akteur:innen repräsentieren.
„Ich glaube nicht, dass es schnell genug geht"
Der Politikwissenschaftler und Redakteur im Haus der Kulturen der Welt, Eric Otieno Sumba, betonte, dass die Debatte über die Restitution kolonialer Raubkunst schon seit geraumer Zeit existiere. Bereits in den 1970er-Jahren forderten junge afrikanische Nationalstaaten die Rückgabe von Kulturgütern, erhielten jedoch oft keine Rückmeldungen oder stießen auf Widerstand. Erst durch aktuelle Nachforschungen wurde das tatsächliche Ausmaß der enteigneten „Objekte“ deutlicher sichtbar – auch in Deutschland. „Allein im Ethnologischen Museum in Berlin reden wir von 500.000 „Gegenständen“. Das ist ein einziges Museum in Berlin. Wir könnten über das Weltkulturen Museum in Frankfurt oder das Iwalewahaus in Bayreuth sprechen. Da kommen wir locker auf bis zu einer Million „Gegenstände“ aus bestimmten afrikanischen Ländern. Es geht nicht nur um Afrika, es geht um asiatische Länder, es geht um Ozeanien. Wenn man das dem gegenüberstellt, wie viel tatsächlich zurückgegangen ist seit 2018, haben wir gar nicht angefangen“, so Otieno Sumba.
„Ich glaube, die Museen haben noch andere Aufgaben“
Museen beherbergen vielfältige Sammlungen mit unterschiedlicher Herkunft. Dennoch müssen sich Ausstellungshäuser mit dem kolonialen Machtgefälle auseinandersetzen. „In der Schule wird das Thema Kolonialismus nicht ausreichend angesprochen“, so Barbara Plankensteiner. „Damit möchten wir uns beschäftigen und einem breiteren Publikum dieses Wissen vermitteln. Eine andere wichtige Aufgabe ist eine Anerkennung von Kultur und Geschichten zu außereuropäischen oder globalen Themen, die sonst in den Kunstmuseen in der Regel nicht vertreten sind“, sagte die Ethnologin. Bei Restitution geht es nicht nur nicht um die reine Rückgabe der „Objekte“, sondern auch darum, den Verlust des damit verbundenen Wissens zu berücksichtigen. Oft kennen Gemeinschaften ihre einstigen Kulturgüter nicht mehr, weil sie über Generationen nicht zugänglich waren. „Als erstes gilt es, diese „Gegenstände“ zurückzubringen und das, was man als „epistemological restitution“ bezeichnet, das heißt das Wissen, was mit den „Gegenständen“ verbunden war“, so Eric Otieno Sumba. Für eine Restitution ist umfangreiche Forschung auf beiden Seiten erforderlich – sowohl durch die Institutionen, die die Sammlungen aktuell besitzen, als auch durch Fachleute in den Herkunftsgesellschaften. Diese Zusammenarbeit scheitert jedoch oft an praktischen Hürden wie Visa-Beschränkungen, die es Forschenden aus betroffenen Ländern erschweren, Zugang zu den Objekten in westlichen Museen zu erhalten.
Die Idee einer Weltkultur und des universellen Zugangs zu Museen sei zwar wichtig, betonte Eric Otieno Sumba, bleibe der überwiegende Mehrheit der Menschen jedoch praktisch verwehrt. „Auf der einen Seite sagt man, dass es diese Idee der Weltkultur gibt und dass jeder im Prinzip Zugang dazu hat. Die Realität ist aber eine ganz andere, die wir nicht aus den Augen verlieren sollten“, so der Politikwissenschaftler. „Wenn der praktische Zugang nicht gegeben ist, wie wollen wir damit umgehen? Wir müssen über digitale Technologien wie zum Beispiel 3D-Modelle nachdenken. Es gibt Methoden, um die Zugänglichkeit trotz der Widrigkeiten, die wir besprochen haben, zu gewährleisten." Andernfalls bleibe der Anspruch auf globalen Zugang lediglich eine Theorie. An der Digitalisierung der Sammlung arbeitet auch Barbara Plankensteiner im MARKK intensiv mit ihrem Team. Vieles sei eine Frage der zu Verfügung stehenden Ressourcen.
„Recht und Moral hängen eng miteinander zusammen“
Der Rechtsanwalt Mathias Zintler gab auf dem Podium rechtliche Einblicke in die Debatte: Die Verpflichtung zur Restitution kolonialer Raubkunst ist in Deutschland zivilrechtlich verjährt, weshalb moralische und historische Argumente wichtiger werden. Während in Großbritannien gesetzliche Regelungen eine Rückgabe oft verbieten, gibt es in Deutschland keine solchen Verbote, sodass Museen eigenständig über Restitutionen entscheiden können. Zintler wies darauf hin, dass Verzögerungen bei der Restitution kolonialer Raubkunst dazu führen können, dass das öffentliche Interesse nachlässt und politische Veränderungen die Prozesse stoppen. Internationale juristische Ansätze, wie die UN-Konventionen und das Menschenrecht auf kulturelle Teilhabe, könnten genutzt werden, um Restitutionen unabhängig vom rein europäischen Eigentumsbegriff zu regeln. Zintler plädierte auch für ein nationales Restitutionsgesetz: „Durch ein Gesetz hätten wir die Möglichkeit, späterer politischer Willkür oder einem nachlassenden Willen einen Riegel vorzuschieben“. Eric Otieno Sumba und Barbara Plankensteiner stimmten dem zu und hoben die Bedeutung der Verstetigung von Prozessen hervor.
Was kann Recht von diesen kulturellen Konflikten lernen?
Mathias Zintler sprach sich dafür aus, kulturelles Erbe nicht nur auf nationaler Ebene zu schützen, sondern es als gemeinsames Erbe der Menschheit zu betrachten. Als Beispiel nannte der Anwalt die Möglichkeit, eine internationale Organisation zu schaffen, die Verantwortung für solche Objekte übernimmt und sie für zukünftige Generationen bewahrt. Diese Idee möge aktuell utopisch wirken – Zintler verwies jedoch auf internationale Initiativen, etwa im Bereich der Biodiversität, die zeigen, dass globale Zusammenarbeit möglich ist.
Mehr zur Reihe „Hinter den Bildern“ lesen Sie hier.
Die Begriffe „Objekte“ und „Gegenstände“ werden in diesem Text in Anführungszeichen gesetzt, da sie die kolonialen Sammlungsstücke sachlich-neutral bezeichnen, während zugleich ihre kulturelle und oft spirituelle Bedeutung für die Herkunftsgesellschaften anerkannt wird. Die Verwendung der Anführungszeichen markiert somit eine kritische Distanz zur oft westlich geprägten musealen Terminologie.