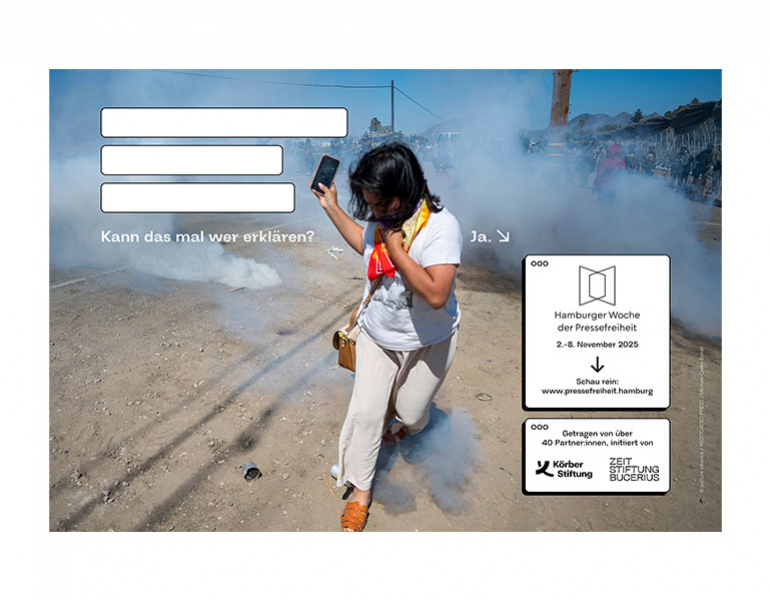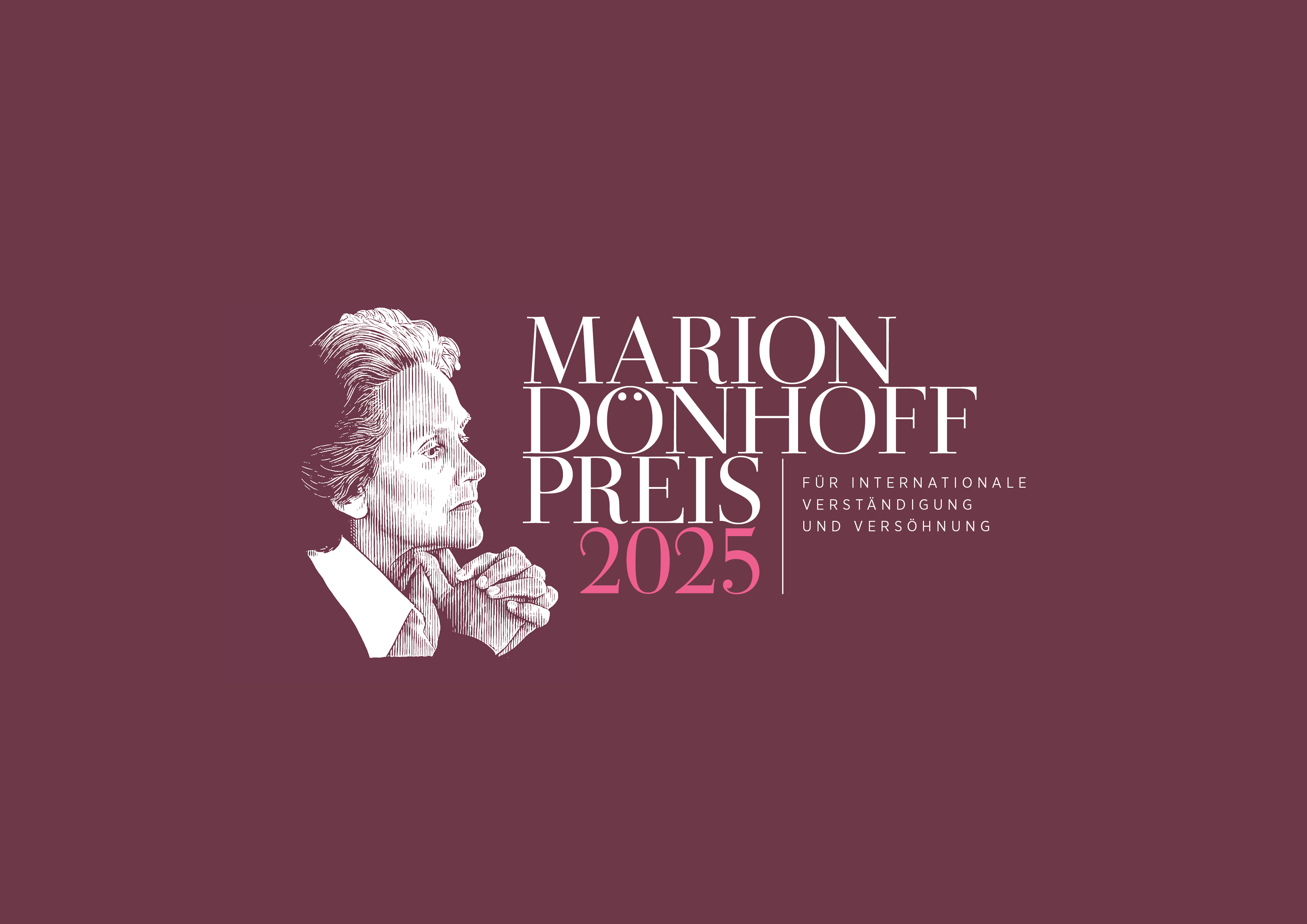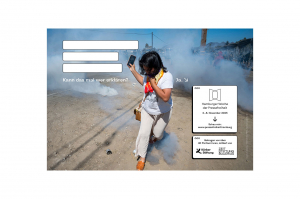Wie wir fördern
Hier erfahren Sie, welche Projekte und Initiativen wir unterstützen – und wie Sie einen Förderantrag stellen.
Weiterlesen
Bucerius Law School: Hochschule mit Vorbildcharakter

Die Bucerius Law School in Hamburg ist Deutschlands erste private Stiftungshochschule für Rechtswissenschaft. Ihr Ziel: das Jura-Studium zu erneuern.
Als Pionierin geht die Bucerius Law School mutig neue Wege in Lehre und Forschung und lebt Internationalität, aber auch Vielfalt und Gemeinschaftssinn vor.
Stipendien und ein innovatives Gebührensystem machen das Studium für jedes Talent unabhängig vom Geldbeutel zugänglich.
Als Pionierin geht die Bucerius Law School mutig neue Wege in Lehre und Forschung und lebt Internationalität, aber auch Vielfalt und Gemeinschaftssinn vor.
Stipendien und ein innovatives Gebührensystem machen das Studium für jedes Talent unabhängig vom Geldbeutel zugänglich.
Weiterlesen
Anna-Politkowskaja-Platz in Hamburg steht seit einem Jahr als „Symbol für Freiheit und Gerechtigkeit“
Weiterlesen
Klimaanlagen und Ausgrenzung im Treppenhaus: Kunststipendiatin Tintin Patrone über ihr Kunstwerk „Condition(s)“
Weiterlesen
Zum 30. Todestag von Gerd Bucerius: Erinnerungen an unser Stifterehepaar und Unternehmer mit „Berlin-Meise“
Weiterlesen
Hamburger Woche der Pressefreiheit 2025: Das hält die Aktionswoche vom 2. bis 8. November bereit
Weiterlesen
Kinder, Kinder!
Zwischen Repräsentation und Wirklichkeit
28.11.2025 — 06.04.2026
Zwischen Repräsentation und Wirklichkeit
28.11.2025 — 06.04.2026

Bucerius Kunst Forum

Wie wir fördern
Hier erfahren Sie, welche Projekte und Initiativen wir unterstützen – und wie Sie einen Förderantrag stellen.
Weiterlesen
Bucerius Law School: Hochschule mit Vorbildcharakter

Die Bucerius Law School in Hamburg ist Deutschlands erste private Stiftungshochschule für Rechtswissenschaft. Ihr Ziel: das Jura-Studium zu erneuern.
Als Pionierin geht die Bucerius Law School mutig neue Wege in Lehre und Forschung und lebt Internationalität, aber auch Vielfalt und Gemeinschaftssinn vor.
Stipendien und ein innovatives Gebührensystem machen das Studium für jedes Talent unabhängig vom Geldbeutel zugänglich.
Als Pionierin geht die Bucerius Law School mutig neue Wege in Lehre und Forschung und lebt Internationalität, aber auch Vielfalt und Gemeinschaftssinn vor.
Stipendien und ein innovatives Gebührensystem machen das Studium für jedes Talent unabhängig vom Geldbeutel zugänglich.
Weiterlesen
Kinder, Kinder!
Zwischen Repräsentation und Wirklichkeit
28.11.2025 — 06.04.2026
Zwischen Repräsentation und Wirklichkeit
28.11.2025 — 06.04.2026

Bucerius Kunst Forum