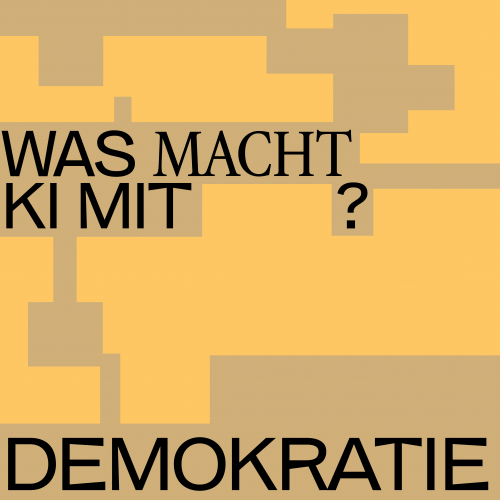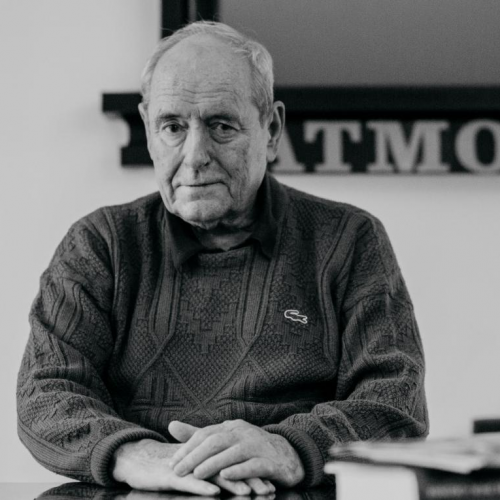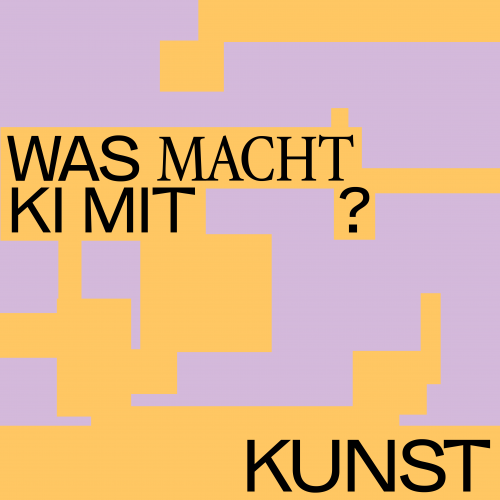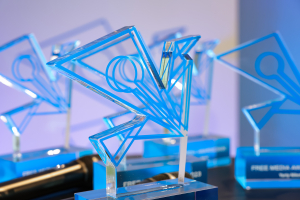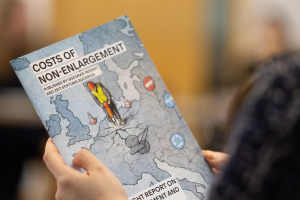Warum wir nun anders aussehen
Nach mehr als 20 Jahren hat die ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius ihr Erscheinungsbild grundlegend überarbeitet – mit einer neuen Website und einem neuen Design.
Weiterlesen
Bucerius Law School: Hochschule mit Vorbildcharakter

Die Bucerius Law School in Hamburg ist Deutschlands erste private Stiftungshochschule für Rechtswissenschaft. Ihr Ziel: das Jura-Studium zu erneuern.
Als Pionierin geht die Bucerius Law School mutig neue Wege in Lehre und Forschung und lebt Internationalität, aber auch Vielfalt und Gemeinschaftssinn vor.
Stipendien und ein innovatives Gebührensystem machen das Studium für jedes Talent unabhängig vom Geldbeutel zugänglich.
Als Pionierin geht die Bucerius Law School mutig neue Wege in Lehre und Forschung und lebt Internationalität, aber auch Vielfalt und Gemeinschaftssinn vor.
Stipendien und ein innovatives Gebührensystem machen das Studium für jedes Talent unabhängig vom Geldbeutel zugänglich.
Weiterlesen

Mehr Männer in Grundschulen – Zweiter Schülercampus für Grundschullehrer von morgen in Hamburg
Einen Traumjob aus der Nähe kennenlernen: Beim zweiten Campus der Initiative „Mehr Männer in Grundschulen“ kamen interessierte Schüler zusammen, um von Lehrkräften, Expert:innen und Studierenden mehr über den Job als Grundschullehrer zu erfahren.
Fit für die Grundschulleitung: Qualifizierungsprogramm „Grundschule voraus“ geht in die zweite Runde
Weiterlesen
Gemeinsam wachsen: Neues Projekt gegen Rassismus und Antisemitismus in Hamburg gestartet
Weiterlesen
Stipendien für Bildende Kunst vergeben – Glückwunsch an sieben neue Kunststipendiat:innen
Weiterlesen
Mythos Spanien.
Ignacio Zuloaga
1870 – 1945
17.02. — 26.05.2024
Ignacio Zuloaga
1870 – 1945
17.02. — 26.05.2024

Bucerius Kunst Forum

Warum wir nun anders aussehen
Nach mehr als 20 Jahren hat die ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius ihr Erscheinungsbild grundlegend überarbeitet – mit einer neuen Website und einem neuen Design.
Weiterlesen
Bucerius Law School: Hochschule mit Vorbildcharakter

Die Bucerius Law School in Hamburg ist Deutschlands erste private Stiftungshochschule für Rechtswissenschaft. Ihr Ziel: das Jura-Studium zu erneuern.
Als Pionierin geht die Bucerius Law School mutig neue Wege in Lehre und Forschung und lebt Internationalität, aber auch Vielfalt und Gemeinschaftssinn vor.
Stipendien und ein innovatives Gebührensystem machen das Studium für jedes Talent unabhängig vom Geldbeutel zugänglich.
Als Pionierin geht die Bucerius Law School mutig neue Wege in Lehre und Forschung und lebt Internationalität, aber auch Vielfalt und Gemeinschaftssinn vor.
Stipendien und ein innovatives Gebührensystem machen das Studium für jedes Talent unabhängig vom Geldbeutel zugänglich.
Weiterlesen
Mythos Spanien.
Ignacio Zuloaga
1870 – 1945
17.02. — 26.05.2024
Ignacio Zuloaga
1870 – 1945
17.02. — 26.05.2024

Bucerius Kunst Forum